
Osteuropa
Zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer sind die Staaten, Städte und
Regionen in Mittel- und Osteuropa noch immer ein "weißer Fleck"
auf der Landkarte vieler Westeuropäer. Daran hat auch der Beitritt
zwölf neuer Länder zur Europäischen Union seit dem Mai 2004
wenig geändert. Im Gegenteil. Die Öffnung der Grenzen zwischen
alten und neuen EU-Staaten hat an der neuen Außengrenze der EU zu
neuen Hürden geführt. Dem gegenüber steht das Bedürfnis
der Menschen, auch in diesen Regionen zusammenzuwachsen. Dabei spielt auch
die oft verdrängte und tabuisierte Regionalgeschichte eine Rolle. Sie
soll nicht mehr länger trennen, sondern verbinden. Dazu aber ist ein
Austausch erforderlich, der nicht neue Mauern braucht, sondern immer weniger.
Der Schwerpunkt Osteuropa auf uwe-rada.de versteht
sich als Beitrag zu dieser grenzüberschreitenden Regionalisierung und
eines postnationalen Blicks auf die Geschichte. Gleichzeitig versucht er,
Themen und Trends nicht aus einer deutschen Perspektive wahrzunehmen, sondern
aus der Perspektive der Menschen vor Ort.
Mein Riesengebirge
Die allererste Wanderung in meinem Leben führte mich durchs Riesengebirge (Nachwort zur Anthologie "Wanderer im Riesengebirge" des Verlags Wielka Izera und des Schlesischen Museums zu Görlitz)
lesen Sie weiter ...
Das Meer in unserer Mitte
Unser Autor ist auf dem Rad um die gesamte Ostsee gefahren, zwölf Etappen in zwanzig Jahren. Die Reise hat auch seine Vorstellung von Europa verändert (taz am Wochenende 17. April 2021)
lesen Sie weiter ...
Kultur statt Kohle
In Kattowitz findet im Dezember 2018 der Weltklimagipfel statt. Obwohl Polen ein Kohleland ist, wandelt sich keine Stadt im Land gerade so schnell wie die oberschlesische Kohlemetropole (taz vom 5. Dezember 2018)
lesen Sie weiter ...
Die "blutende" Grenze
2018 jährt sich zum hundertsten Mal die polnische Unabhängigkeit und die Grenzziehung zu Deutschland. Der Kampf um die "Ostmark" blieb bis zum Ende der Weimarer Republik ein Thema deutscher Nationalisten (taz vom 9. November 2018)
lesen Sie weiter ...
Den einen Osten gibt es nicht
Europa ist das Europa der Regionen und der Vielfalt. Diese zu schätzen braucht es freilich Neugier und Empathie und weniger Fingerzeige gen Osten. Denn die Zukunft Europas ist ungewiss (Rotarier-Magazin 2/2018)
lesen Sie weiter ...
Der Sammler Europas
Der große kroatische Kosmopolit Predrag Matvejevic ist tot. Ein Nachruf (taz-eins vom 6. Februar 2017)
lesen Sie weiter ...
Fremd und doch vertraut
Die Berliner Fotografin Ann-Christine Jansson fuhr nach Breslau, ihre Breslauer Kollegin Alicja Kielan kam nach Berlin. Mit ihrer Kamera fingen beide viel Gemeinsames ein (b-taz vom 22. Oktober 2016)
lesen Sie weiter ...
Raum für Pioniere
Dass Breslau Europäische Kulturhauptstadt wurde, hat auch mit dem Gründerzeitquartier Nadodrze zu tun. Wie Kreuzberg in es ein Symbol des Aufbruchs (taz vom 17. Mai 2016)
lesen Sie weiter ...
Eine neue Linke für Polen
Die junge Partei Razem will Politik für sozial Benachteiligte machen – und kritisiert den autoritären Ansatz der Regierung, erklärt Aleksandra Cacha (taz-Schwerpunkt vom 12. Februar 2016)
lesen Sie weiter ...
Breslau will europäisch bleiben
Bei den Feierlichkeiten zum Auftakt des Kulturhauptstadtjahrs 2016 setzte die Stadt an der Oder ein klares Signal für ein demokratisches Polen (taz-Kultur vom 19. Januar 2016)
lesen Sie weiter ...
Nur das Meer ist noch das gleiche
In der ukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa ist der Kiewer Maidan so weit weg wie der umkämpfte Donbass. Viele glauben noch an die vielgerühmte odessitische Identität. Doch die ist bedroht (taz Reise vom 7. November 2015)
lesen Sie weiter ...
Europa ist mehr als ein Event
Breslau wird 2016 Europas Kulturhauptstadt. Die Stadt ist ein Ort des zivilen Ungehorsams. Aber um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, muss die Generation der Solidarność den Weg für die Jungen freimachen (taz Kultur vom 22. Juli 2015)
lesen Sie weiter ...
Europa sollte aus den Fehlern Jugoslawiens lernen
Nataša Kramberger lebt seit 2004 in Berlin. In ihrem neuen Buch vergleicht die slowenische Schriftstellerin die Wendeerfahrungen in Berlin mit denen in Slowenien, Serbien, Bulgarien oder Kuba (b-taz Interview vom 1. November 2014)
lesen Sie weiter ...
Wunder an der Adria
Vom Meer des Eisernen Vorhangs ist die Adria an vielen Orten zu einem Meer der Regionen geworden. Vor allem in Istrien hat die regionale Identität den Nationalismus verdrängt. Doch es zeigt sich auch ein Nord-Süd-Gefälle (Vortrag beim Symposium "Mentalitätsgeschichte der Adria", unter anderem mit EU-Kommissar Johannes Hahn, Ilse Fischer, Marino und Martina Vocci, Flavio Bonin und Mirt Komel vom 17.-19. Oktober 2014 in Piran, Slowenien)
lesen Sie weiter ...
Zurück zur Triestinità
Zwischen Österreich, den Staaten des ehemaligen Jugoslawien und Italien hin- und hergerissen: Triest an der Adria muss sich laufend neu erfinden. Die Grenzstadt tut sich nicht immer leicht damit. (Auszug aus dem Buch "Die Adria. Die Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsortes", taz-Kultur, 3. September 2014)
lesen Sie weiter ...
Das Illy-Meer
Bis in die Neuzeit war die Adria ein venezianisches Meer. Doch dann ging es epochenweise bergab. Und heute? Eine Umrundung in fünf Etappen (sonntaz vom 20. Oktober 2012)
lesen Sie weiter ...
Anarchie ist echt anstrengend
Europa statt Nationalismus: Polens Ratspräsidentschaft zeigt sich auf dem europäischen Kulturkongress in Breslau von der überraschenden Seite – und öffnet sich der kulturellen Linken (taz Kultur vom 12. September 2011)
lesen Sie weiter ...
Harte Kost aus dem Hinterhofland
Heimat kann ein Ort sein, aber auch Geschichte. Volker Koepp hat in seinem Dokumentarfilm "Berlin-Stettin" beides gefunden (taz-Medien vom 24. August 2011)
lesen Sie weiter ...
Dunkle Sonnenstadt
Deutschland ist Gastland auf der Buchmesse in Minsk und will Farbe bekennen (taz-Kultur vom 11. Februar 2011)
lesen Sie weiter ...
Auf nach Belarus!
Weißrussland ist noch immer ein weißer Fleck auf der Landkarte Europas. Umgekehrt kennen viele Weißrussen den Westen. Je intensiver der Dialog zwischen den Menschen ist, desto schwieriger wird es für das autoritäre Regime. Ein Plädoyer (tazzwei vom 26. Januar 2011)
lesen Sie weiter ...
Oder und Memel. Alte und neue Grenzen in Europa
Vortrag zum Abschluss der Veranstaltungsreihe "1990 als Epochenzäsur" im Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte in Potsdam am 4. November 2010
lesen Sie weiter ...
Wo liegt Sankt Petersburg?
Das Verhältnis der größten Stadt an der Ostsee zu ihren Nachbarn war von Anfang an schwierig. Doch das muss nicht so bleiben. Ein Blick in die Zukunft anhand von vier Kartenbildern (Stadtbauwelt 186, 2010)
lesen Sie weiter ...
Königin des Ostens
Luise in Russland und Litauen (Vortrag bei der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten im Rahmen der Ausstellung "Luise. Leben
und Mythos der Königin" am 20. März 2010)
lesen Sie weiter ...
Miss Preußens Rückkehr
Zweihundert Jahre nach ihrem Tod wird Königin Luise in zahlreichen
Ausstellungen gefeiert - und als moderne Frau gepriesen. Doch nicht nur
die Deutschen entdecken die preußische Königin der Herzen wieder,
sondern auch Litauer und Russen (tazzwei vom 24. Februar 2010)
lesen Sie weiter ...
Ein Foto aus Wilna
Litauer, Juden, Polen: Im ehemaligen "Jerusalem des Nordens" gibt
es so viele Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, wie es Nationalitäten
gibt. Eine Reportage (taz Kultur vom 17. September 2009)
lesen Sie weiter ...
Der totalitäre Faktor
Der Krieg als Mutter aller Utopien: Die polnische Künstlerin Aleksandra
Polisiewicz hat sich die Pläne des NS-Regimes für die "Deutsche
Stadt Warschau" angeschaut. Auch polnische Architekten setzten auf
die Tabula rasa als Voraussetzung für Erneuerung. Polisiewicz "Wartopia"
ist in Berlin ausgestellt (taz Kultur vom 22. Januar 2009)
lesen Sie weiter ...
Schleichende Autos
Ungewöhnlich ist es schon, von Narva bis Petersburg und von dort bis
Vyborg mit dem Rad zu fahren. Eine Etappe zur Umrundung der Ostsee (taz
Reise vom 20. September 2008)
lesen Sie weiter ...
Plötzlich diese
Intentsität
Was ist das Faszinierende an Osteuropa? Ist es die Suche nach dem eigenen
Orient oder die neue Aktualität von Mitteleuropa nach dem Ende des
Eisernen Vorhangs? Ein Bekenntnis (taz Reise vom 13.September 2008)
lesen Sie weiter ...
Still, langsam, schweigend
Hinter dem Eisernen Vorhang war die Memel lange Zeit in Vergessenheit geraten.
Ihren Namen verband man mit deutscher Großmannssucht. Dabei ist die
Memel gerade in ihrer Bescheidenheit so berückend (taz Magazin vom
5. Juli 2008)
lesen Sie weiter ...
"Ich will Menschen
porträtieren, die ich mag"
Gerade läuft sein Film "Holunderblüte" in den Kinos.
Darin beschreibt der Dokumentarfilmer Volker Koepp das Leben von Kindern
im einstigen Ostpreußen, das nun zum Kaliningrader Gebiet und zu Russland
gehört. Natur und Geschichte sowie die Menschen, die dort leben, sind
sein Thema, auch in zahlreichen Filmen über Brandenburg. Ein Gespräch
über Heimat, Preußen und Identität (taz vom 17. März
2008)
lesen Sie weiter ...
Der Hinterhof von Warschau
boomt
Einst war Lódz die größte Textilstadt Europas. Nach der
Wende brach die Produktion zusammen. Im Schatten der Hauptstadt scheint
Lódz seine Rolle nun gefunden zu haben - als polnischer Billiglohnstandort
mit kulturellen Enthusiasten (in: Jahrbuch Polen "Stadt" des Deutschen
Polen Instituts 2007)
lesen Sie weiter ...
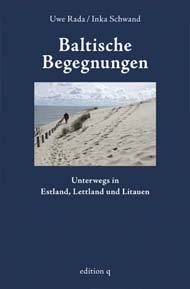 Baltische Begegnungen
Baltische BegegnungenEin
neues Sarajevo nur für Serben
Die bosnische Hauptstadt ist gespaltener denn je. Wahhabitische Islamisten
treten aggressiv auf, die serbische Bevölkerung zieht sich zurück,
und die Stadtplanung steht im Dienst der Trennung. Serbische Planer entwickeln
eine eigene Satellitenstadt (taz Kultur vom 12. November 2007)
Ostseeküste
auf zwei Rädern
Eine Reise von Riga und Tallinn mit dem Rad ist längst kein Geheimtipp
mehr. Vor allem Estland ist ein Fahrrad-Musterland (aus Uwe Rada/Inka Schwand:
Baltische Begegnungen)
Balkanmetropole
ohne Plan
Am 1. Januar wird Bulgarien der EU beitreten. Anders als viele Metropolen
in Europa wächst die Hauptstadt Sofia rasant. Zur Wende gab es 800.000
Einwohner, heute sind es 2 Millionen. Einen städtebaulichen Plan gibt
es nicht. Den soll die EU bringen (taz Kultur vom 29. September 2006)
Die
Wiederentdeckung der Oder
Unter Europas Strömen galt die Oder lange als Neutrum. Doch allmählich
entwickelt sich links und rechts des Flusses ein Bewusstsein vom gemeinsamen
Kulturraum, erwacht das Interesse an den Nachbarn (taz Magazin vom 17. Dezember
2005)
Ein
Fortschrittsbericht
In einem Jahr soll Rumänien zur Europäischen Union gehören.
Doch in der EU-Kommission macht man sich "ernste Sorgen" über
schleppende Reformen. Eine Reise in ein Land, in dem noch vieles wirkt wie
aus einer anderen Zeit (taz Magazin vom 11. März 2006)
Die
Neuerfindung der Ukraine
Oranger Westen, blauer Osten - so einfach schienen sich in der Berichterstattung
die politischen Lager innerhalb der Ukraine zunächst aufzuteilen. Doch
während der letzten Woche hat der Konflikt um die Präsidentenwahlen
das Modell einer offenen, postsowjetischen Zivilgesellschaft hervorgebracht
(taz Kultur vom 3.Dezember 2004)
Kriechströme
und Korridore
Europas Osten teilen nicht nur alte und neue Grenzen, sondern auch verschiedene
Geschwindigkeiten (Magazin der Berliner Zeitung vom 23. März 2002)
Die
Welt hinter der Schranktür
Der Schtetl-Tourismus in Osteuropa ist eine Mischung aus kommerzieller Inszenierung
und engagiertem Erinnern. Mit "Schindler's List Tours" durch die
Kulissen vergangenen Lebens (taz Magazin vom 23. August 2003)
Zukunft
in the Ghetto
In der Altstadt von Vilnius soll das ehemalige jüdische Viertel wieder
aufgebaut werden. Das Projekt hat eine heftige Debatte um die Identität
Litauens ausgelöst: Wie viel Geschichte verträgt ein Land? (taz
Kultur vom 17. August 2002)
Wenn
Schmuggler sich rasieren
Die Phase der Basarwirtschaft in Osteuropa ist noch nicht zu Ende. Mit den
neuen Außengrenzen Europas wird aber nicht nur eine neue Grenze zwischen
Ost und West gezogen, sondern zum Beispiel auch der Ameisenhandel zwischen
Sarajevo und dem neuen "Chinesenmarkt" in Budapest durchschnitten
(taz Kultur vom 30. Mai 2001)
Warten
auf Mr. Bloomfield
In Lodz ist Amerika noch immer eine Metapher der Hoffnung, der Traum vom
gelobten Land